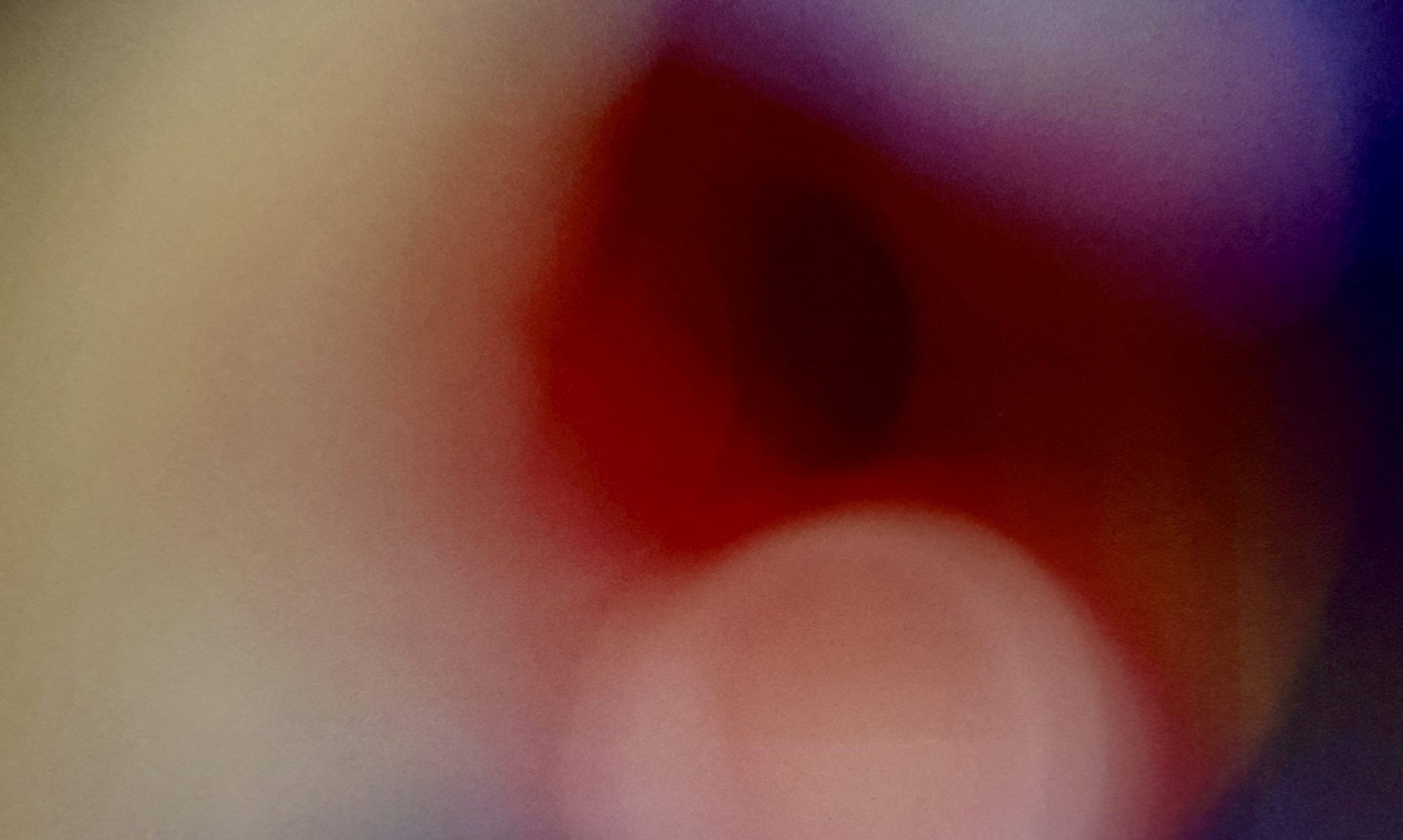Ich male nicht, um Antworten zu geben. Ich male wie ein Kind.
Vielleicht ist das mein freundlichster Beitrag zur Wirklichkeit.
Vom Glück ein Banause zu sein. (⏎)
Im alten Griechenland gab es ein Wort für jene, die mit den Händen schufen: banauson – ein „ungebildeter Handwerker“, ein Mensch, der das Denken dem Tun überließ.
Kein Philosoph,
kein Dichter.
Ein Banause eben.
Ich kenne das Wort gut. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Es klebte an mir wie Lehm an den Schuhen. „Du Banause“, sagten die Erwachsenen, wenn ich mal wieder anders dachte, anders sah, anders fühlte. Ich habe das nie als Beleidigung empfunden. Ich fühlte mich tatsächlich gemeint.
Auch heute stehe ich dazu. Ich bin ein erwachsener Banause.
Und auf dieser Website sehen Sie, was dabei herauskommt, wenn einer wie ich malt, ohne zu fragen, was man darf, soll oder müsste.
Erwarten Sie bitte keine treue Wiedergabe der Wirklichkeit. Und auch nicht das, was man heute „moralisch vertretbar“ oder „ästhetisch anschlussfähig“ nennt.
Ich male nicht, um zu gefallen.
Ich male, um zu finden.
Manche würden sagen: Das ist informelle Malerei.
Andere sprechen von „autonom“.
Ich finde das alles sehr höflich. Und ziemlich nutzlos.
Denn die Begriffe sind oft nicht mehr als saubere Etiketten auf einem Glas, das beginnt zu verstauben.
Worauf es mir ankommt, ist das Ungefähre, das Ungezähmte, das, was sich jeder Deutung entzieht.
Nicht die Erklärung, sondern die Erfahrung.
Nicht die Einordnung, sondern der Eindruck.
Vielleicht ist meine Malerei ein bisschen wie das Leben selbst:
nicht ganz zu fassen, nicht ganz zu benennen –
aber voller Spuren, Risse, Lichtstellen, Widerstand.
Ich verzichte auf weitschweifige Einführungen, kunsthistorischen Rettungsringen.
Die Bilder stehen für sich.
Und manchmal, wenn das Licht richtig fällt,
leuchten sie leise.