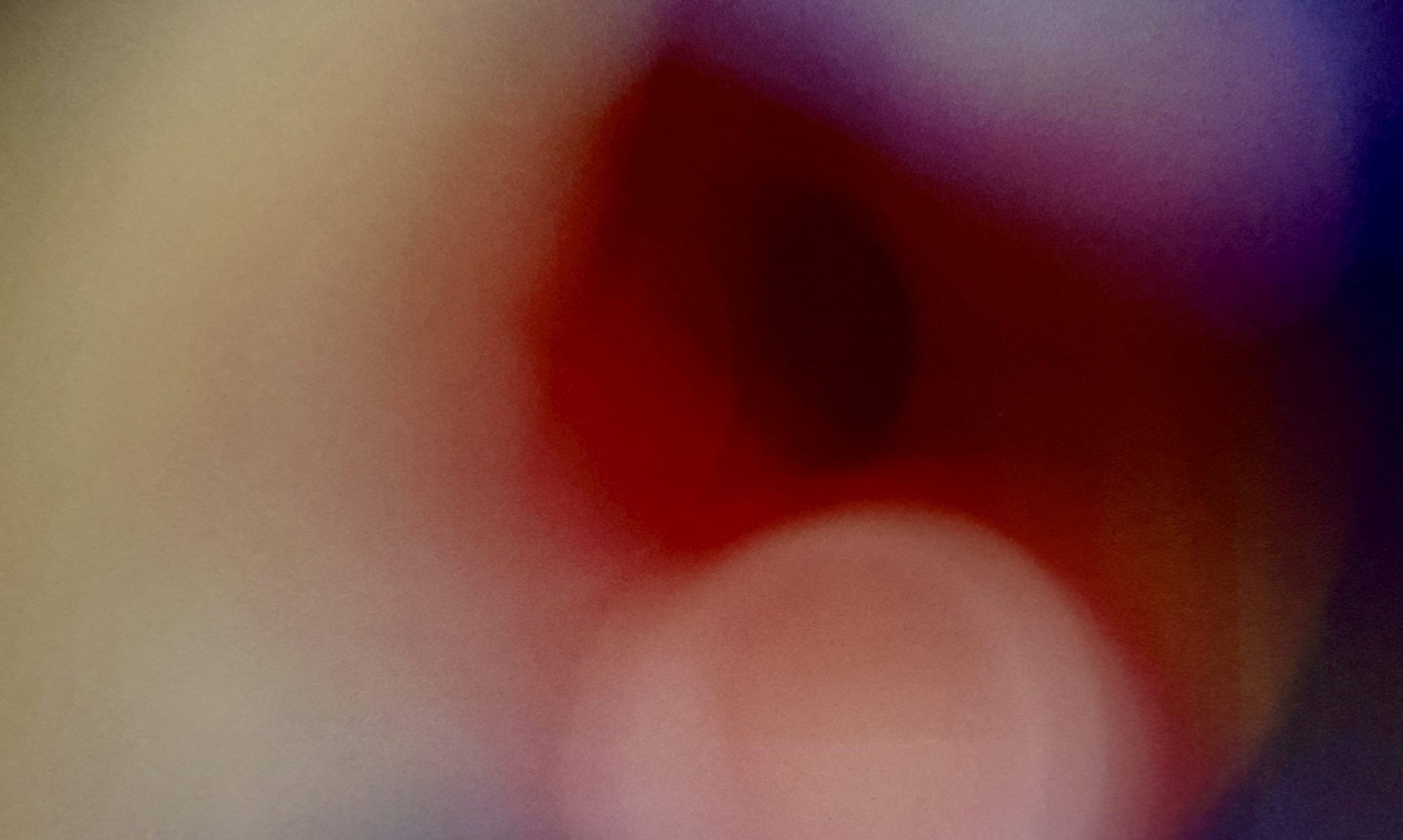Teekanne

Wurzel des Atems
Hūxī zhī gēn hú
呼吸之根壶
Friederike kam an einem Nachmittag vorbei, an dem das Licht flach über den Tisch strich. Winterlicht. Sie sah die Teekanne auf dem großen Tisch. Ihre Finger glitten über den Astgriff. Alt. Trocken. Warm vom Raum.
Sie lächelte, neigte sich mir zu und flüsterte: „Manche Dinge wollten getragen werden, andere gehalten.
Diese Kanne will beides.“

Behälter
Wenn ein Gefäß einen Deckel hat, ist es dann automatisch eine Dose? Oder ist es eine Schatulle? Oder ein Topf? Nein, es ist ein Behälter. Es behält und bewahrt all die guten Dinge, die mir so viel bedeuten.
Diese seltsamen Perlen, die ich neulich auf dem Dachboden entdeckte und auf jeden Fall der wertvolle Matcha-Tee aus Japan. Der, den ich in meiner neuen Matcha-Schale zu einem wunderbaren Tee rühren werde.
Moosrand

Moosrand
苔縁
Koke-buchi
Der Ton trägt Druckstellen, wie ein Körper Spuren trägt, wenn er lange gearbeitet hat. Nichts wurde versteckt. Alles durfte bleiben. Ein dunkler Ring läuft um den Bauch. Er ähnelt feuchter Erde nach einem Nachtregen. Darin kleine Blasen, wie eingeschlossene Atemzüge. Ein Opfer an den Brennofen.
Die Glasur zieht darüber hinweg wie Moos über den Stein. Manche Stellen lässt sie offen. Andere hält sie zurück. Diese Schale passt zu Holz. Zu einem Tisch, der schon vieles gesehen hat. Zu einem Tee aus dem Tal der Nebel.
Zu einem Moment ohne Ziel.
Hagerich

Hagerich
Der Name Hagerich kommt aus einer alten, heute fast verstummten Wortschicht. Hager bezeichnete einst etwas Schmalgewordenes, vom Übermaß befreit, gesammelt in seiner Essenz. Hagerich meint zugleich eine Gestalt am Rand. Einen, der leicht aus der Ordnung tritt und darin Haltung findet.
Schief zur Linie, fest im Stand.
Die Form verjüngt sich nach unten. Sie wirkt gespannt, gesammelt, wach. Der Körper trägt Spuren, ohne sie auszustellen. Wie eine Haltung, die sich bewusst setzt.
Dieses Kurinuki-Gefäß ist für Menschen, die Reduktion als Disziplin verstehen. Menschen, die im Unregelmäßigen Präsenz lesen. An Augen, die wissen, dass Form aus Wegnahme entsteht.
Ein Samstag im Winter
Samstag. Winter. Der Schnee fällt, als hätte jemand oben beschlossen, die Welt noch einmal weich zu zeichnen. Die einen sprechen von Katastrophe. Termine kippen, Autos schmollen, der Wetterbericht klingt wie ein Arzt mit Stirnfalte. Die anderen lächeln still. Endlich.
Die Flocken kommen dick herunter. Keine hastigen Krümel. Große, gemächliche Dinger, die sich Zeit lassen. Grau liegt in der Luft, Weiß legt sich darüber und tut so, als sei alles sortiert. Eine freundliche Täuschung. Ich lasse sie gelten.

Drinnen Wärme. Diese ehrliche, träge Wärme, die an den Füßen beginnt und langsam nach oben steigt. Draußen Atem, der kurz sichtbar wird. Ein kleiner Nebel vor dem Mund, ein flüchtiger Gedanke. Man haucht sich selbst an und schaut ihm beim Verschwinden zu. Auch eine Form von Philosophie.
Der Schneeschieber ruft. Ein leiser, metallischer Ruf aus dem Keller. Die Nachbarn hören ihn ebenfalls. Man erkennt das an den Türen. Sie gehen auf. Menschen tauchen auf, bewaffnet mit Besen, Schaufeln, Improvisationen. Treffpunkt Straße. Keine Einladung. Keine Tagesordnung. Einfach da.
Lachen. Erstaunen. Diese plötzliche Verbrüderung durch kalte Hände. Rote Ohren überall, Nasen in allen Schattierungen zwischen Apfel und Backstein. Einer erzählt etwas über früher, als der Schnee noch höher lag und die Erinnerungen tiefer. Alle nicken. Niemand prüft die Fakten. Der Schnee deckt auch Zweifel zu.
Schwitzen beim Fegen. Eine merkwürdige Mischung. Der Körper arbeitet, die Kälte schaut zu. Der Atem geht schneller, der Rhythmus stimmt sich ein. Kratz, schieb, klirr. Musik für Samstage ohne Termine. Worte fliegen hin und her, bleiben kurz hängen, fallen dann in den Schnee und verschwinden. Ein kollektives Einverständnis stellt sich ein. So könnte es öfter sein.
Ich bleibe stehen. Stütze mich auf den Besen. Ein alter Mann im Körper eines Menschen mittleren Alters. Der Augenblick trägt. Er braucht keine Verbesserung. Ach. Dieses Wort reicht. Es hängt in der Luft wie eine Flocke, die ihren Platz sucht.
Drinnen wartet der Tee. Er wartet geduldig. Mehrere Sorten stehen bereit. Auswahl. Luxus in Keramik. Tassen, selbst hergestellt, mit kleinen Macken, die jede für sich eine Geschichte tragen. Grün. Schwarz. Kräuter, die nach Sommer riechen und dem Winter die Stirn bieten. Oder Kaffee. Dunkel, bitter, zuverlässig. Vielleicht später ein Bier. Der Gedanke taucht auf, setzt sich kurz, schaut sich um. Heute Abend sagt er. Geduld sagt er auch.
Diese Abfolge von Entscheidungen. Klein. Unscheinbar. Und doch voller Gewicht. Der Samstag besteht aus ihnen. Tee oder Kaffee. Fenster auf oder zu. Noch ein Blick nach draußen oder schon nach innen. Die Welt stellt Fragen, sanft, ohne Druck. Antworten kommen von selbst.
Ich gieße Wasser auf. Dampf steigt auf, ein warmer Geist. Der Duft breitet sich aus, besetzt den Raum. Der erste Schluck. Der Körper versteht sofort. Schultern sinken. Der Tag setzt sich. Ich setze mich mit ihm.
Draußen wird weiter geschoben. Stimmen entfernen sich. Der Schnee bleibt. Er hat Zeit. Ich auch. Tief in meinem Seelengrunde regt sich etwas Helles. Ein ruhiges Wissen. Verbundenheit ohne Erklärung. Versorgung ohne Rechnung. Das Bewusstsein atmet leise und sagt: hier.
Glück zeigt sich selten laut. Es kommt ohne Fanfaren. Es sitzt am Küchentisch, hält eine Tasse und schaut aus dem Fenster. Jetzt. Genau jetzt. Der Samstag nickt mir zu. Ich nicke zurück.
Wunderbar.
Seelengrund
Ein Ding für die Seele und den Alltag.

Seelengrund
Dieser Becher ist nicht nur ein leerer Raum mit interessanten Wänden. Er ist leer im Sinne von offen. Wer Tee eingießt, merkt: Der Becher macht, was er soll. Er hält den Tee. Mehr will er auch gar nicht. Und dennoch: Die Gedanken werden langsamer.
Ein Kind würde sagen: Er hört zu.
Ein Mensch gießt Tee ein und merkt, dass er nichts denkt.
Ein anderer hält den Becher und spürt sein Gewicht, ohne es zu bewerten.
Ein dritter sitzt am Tisch und merkt, dass der Moment genügt.
Meister Eckhart würde sagen: In solchen Momenten berührt der Mensch seinen Grund.
Dieser Becher hat nichts Erhabenes. Und genau darin liegt seine Tiefe. Er kommentiert nicht. Er beschleunigt nicht. Er rechtfertigt sich nicht. Er hält. So wirkt Seelengrund.
Morgenstille

Morgenstille
Asa no Shizuka
朝の静か
Ich hoffe sehr, dass dieser besondere Becher eines Tages in ein Haus mit knarrenden Dielen einzieht. Dort könnte dann ein Kind morgens warme Milch daraus trinken und in den Kreisen unten an der Basis seines Bechers kleine Seen sehen. Ein alter Mann kann ihn abends in beiden Händen halten und sich an Sommer erinnern, die längst vergangen sind.
Der Becher hilft dabei. Er sammelt nicht nur Wärme, sondern auch Worte und Pausen. Er hält nichts fest, was man loslassen wollte, aber er bewahrt alles was guttut. Sorgen rutschen von seiner Glasur ab. Freude bleibt einen Augenblick länger. Tag für Tag. Wie ein stilles Versprechen.
Nur noch Namen, keine Zahl
Das Jahr 2026 markiert einen Schnitt. Nicht nur den Wechsel von einem Jahr zum anderen, sondern einen bewussten Wechsel in meiner Werkstatt. Nach vier Jahren intensiver Arbeit mit der japanischen Kurinuki-Technik, zahllosen Stunden und Gesprächen mit meinem Freund und Töpfermeister Paul Günther habe ich eine Konsequenz gezogen: Ich werde nur noch meine stärksten Arbeiten zeigen. Alles andere bleibt Teil des Prozesses, verschwindet aber aus der Öffentlichkeit. Kein Verkauf. Keine Zugeständnisse.

Der Kokoro-Kurinuki-Stil ist meine Sprache im Ton geworden. Herz, Geist und Bewusstsein finden darin ihren Ausdruck. Die Subtraktion bleibt selbstverständlich zentral. Auch weiterhin keine elektrische Drehscheibe, nur Ton, wenige Werkzeuge und meine Hände. Aus dieser konzentrierten Präsenz entsteht Form, Proportion, Farbe, Oberfläche. Neu hinzu kommt eine Namensgebung. Der Name gibt den Werkstücken eine Identität, macht sie damit unverwechselbar, schließt den künstlerischen Kreis.

Was bleibt, trägt einen Namen und erlangt die damit verbundene Magie. Wer so ein Gefäß hält, spürt: Es ist kein Objekt. Es ist ein Gegenüber.
Stiller Mondschläfer

Stiller Mondschläfer
Seigetsu no nemurite
静月の眠り手
Ich vermute, dass Stiller Mondschläfer den Mond nicht hören kann. Nur sein Licht kann er sehen, vielleicht noch seinen langsamen Gang. Dieses ruhige Ziehen über den Himmel, das Dinge geduldig macht. Deshalb fürchtet er das Feuer im Brennofen auch nicht. Die Hitze wird ihn umarmen. Seine Struktur wird fest. Die Glasur beginnt zu fließen und findet ihre eigenen Wege. Kleine Entscheidungen. Unumkehrbar. Aber von großer Bedeutung für die zukünftige Teekanne.
Später bekommt er seinen Henkel. Einen Arm, der das Tragen zu einem Kinderspiel macht. Auf dem Deckel wird ein Griff aus Holz plaziert, wie ein stiller Wächter.
Wenn sich Tee in ihm befindet, wird er seiner Bestimmung folgen. Und irgendwo draußen wandert der Mond weiter, ein wenig langsamer, als man denkt.