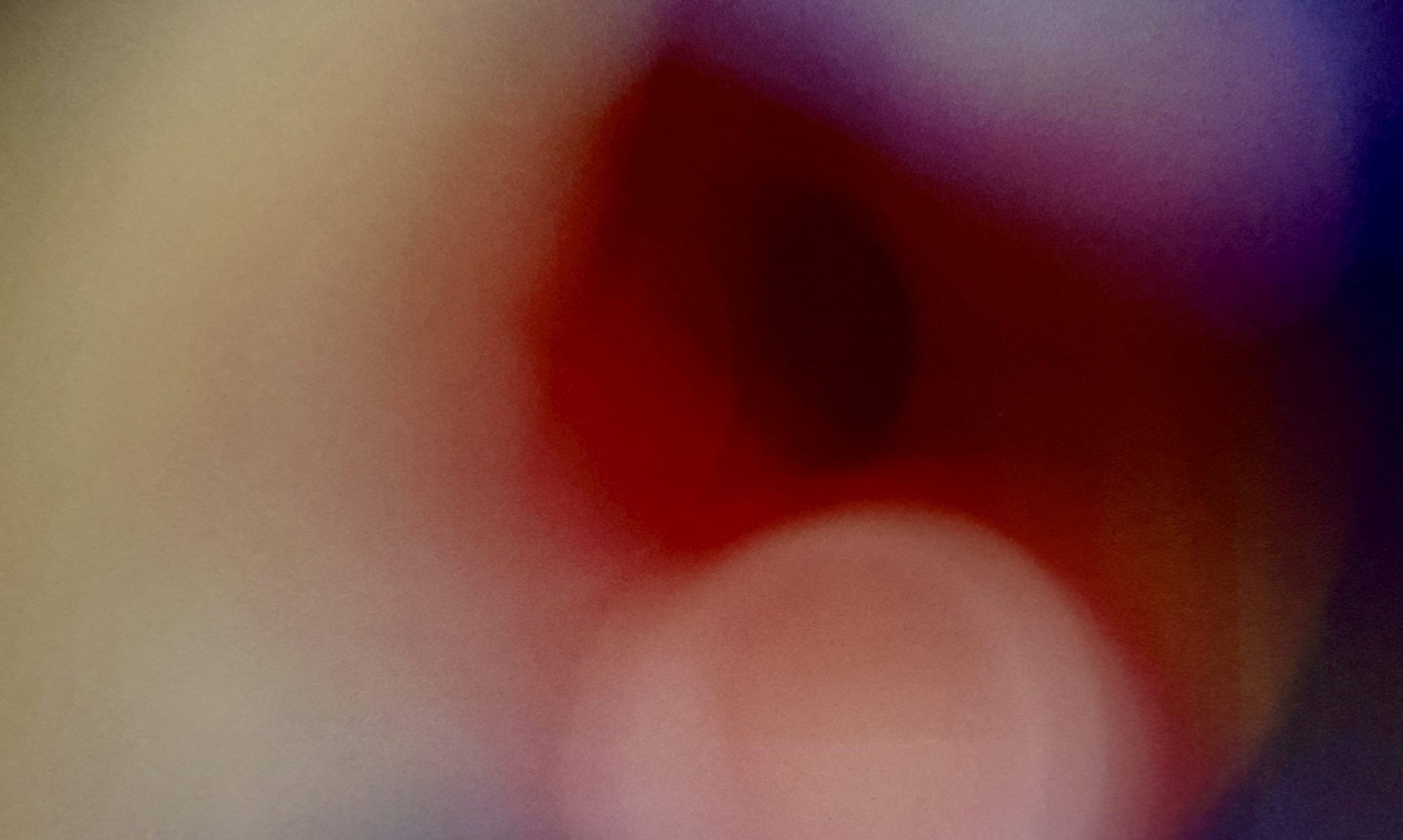Manche sagen, dass sie in den Häusern, in denen sie steht, ihre eigenen Wege geht.
Nicht jeder kann sie sehen. Natürlich, mit den Augen schon – da steht sie, dunkel und erdverbunden, mit ihrem hölzernen Wächter. Doch ihre wahre Gestalt zeigt sie nur denen, die bereit sind, zuzuhören.
Ihr Ton, so schwarz wie die tiefste Nacht, scheint das Licht zu schlucken. Doch wenn man sie aus dem richtigen Winkel betrachtet, flackert etwas darin auf – ein Echo vergangener Rituale, ein Hauch von alten Geheimnissen. Ihr Rand ist nicht zufällig geformt. Er trägt Spuren, als hätte die Zeit selbst ihn mit Fingerspitzen berührt.
Das Voodoo-Holz erhebt sich über ihr wie ein Totem. Zwei Gesichter, schweigend, doch wachsam. Sie sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem Wissen alter Zeiten. Und wer es wagt, die Schale mit einer Flüssigkeit zu füllen, entfacht ihre Magie.
Wasser spiegelt mehr als das Gesicht – es zeigt das, was verborgen ist.
Wein ruft Erinnerungen herbei, selbst die, die vergessen schienen.
Tee zieht das Glück an, langsam, süß und unwiderruflich.
Doch manchmal, in stillen Nächten, wenn der Raum in Dunkelheit getaucht ist, beginnt sie zu flüstern. Kein Laut, den man mit den Ohren hören kann – eher ein Summen tief im Inneren. Die Luft um sie scheint sich zu bewegen, als würde sie nach etwas greifen. Nach einem Wunsch, einem Gedanken, einer Hoffnung.
Manche sagen, dass sie in den Häusern, in denen sie steht, ihre eigenen Wege geht. Dass sie ihren Platz verändert, sich unmerklich dreht, dass man die Räume manchmal mit einem Gefühl betritt, das eben noch nicht da war.
Doch sie fordert nichts. Sie nimmt nur das auf, was ihr anvertraut wird.
Ein Gefäß der Magie.
Ein Portal der Erde.
Ein Hüter von Dingen, die nur die Nacht kennt.