
Fertig zum Brennen


photographs | ceramics & more

Das Wetter, das mir über die gesamten Tage mehr als nur hold war, wird nun zunehmend schlechter. Es ist, als hätte das Universum beschlossen, dass mein Urlaub enden muss und dies mit einem dramatischen Wetterumschwung unterstreichen möchte. Ich werde auch langsam müde. Es sind die vielen Eindrücke, versuche ich mir einzureden, die mich müde machen, das immerwährende Aus- und Einpacken, die langen Autofahrten und die Tatsache, dass ich nicht einfach nur munter plaudern kann mit den Menschen in den fremden Ländern, weil ich ihre Sprache nur unzureichend beherrsche. Während ich so denke, entscheide ich in aller Früh: Ich beende die Reise.
Gegen Mittag bin ich wieder in Wesseling. Erstaunlich, wie schnell es plötzlich ging. Die Trüffel, die ich auf einem Markt in Frankreich erstanden habe, gibt es zum Mittagessen. Genial. Frischer Trüffel ist wirklich ein echter Hochgenuss. Während ich die Trüffel genieße, denke ich darüber nach, wie leicht man sich an das Besondere gewöhnt. Heute Trüffel, morgen wieder Tiefkühlpizza.
Das Ende einer Reise ist wie das letzte Stück Schokolade in der Packung – man weiß, dass es kommt, aber wenn es da ist, trifft es einen doch unerwartet. Die Rückkehr zur Normalität ist der bittere Nachgeschmack nach all den süßen Abenteuern, die man erlebt hat. So sitze ich also wieder in meinem vertrauten, aber ungemütlich wirkenden Wohnzimmer und starre auf den leeren Koffer, der noch die Spuren meines letzten Abenteuers trägt.
Aber keine Sorge, die nächste Reise ist schon in Arbeit. Gleich morgen werde ich mit der Planung beginnen. Vielleicht wird es diesmal Island? Oder doch lieber Dänemark? Die Welt ist groß, und ich habe noch lange nicht genug gesehen. Die Melancholie der Rückkehr ist nur der Auftakt zu neuen Abenteuern. Denn eines habe ich auf dieser Reise gelernt: Jeder Abschied ist auch ein neuer Anfang.
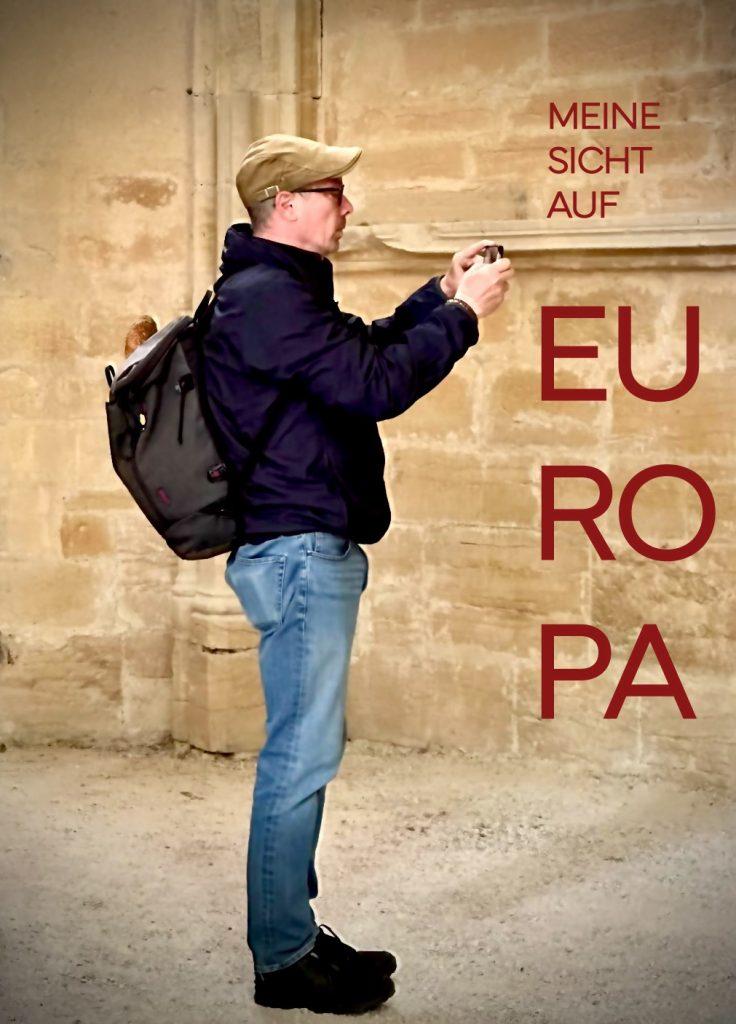
Ende
Die Ermitage de Barcan im Wald von Darney ist heute mein Ziel. Tief in den Wald geht es hinein. Ein langer Fußmarsch im kniehohen Gras. Unterwegs begegnet mir ein Jäger mit geladener Flinte. Ein heftiges Kopfnicken, als ich ihn nach dem Weg frage, aber keine gescheite Antwort. Na gut, denke ich, hoffentlich knallst du mich nicht aus Versehen ab. Weiter geht’s, immer tiefer in den Wald hinein.
Dann ein Schild: „Eremitage in 1,6 Kilometern“. Man glaubt ja gar nicht, wie lang ein Weg werden kann, wenn man durch nasses Gras gehen muss und schon nach kurzer Zeit klatschnass ist… Doch dann, in einer Senke, eigentlich kaum zu sehen, geht eine kleine Holzbrücke über einen Bach. Noch über eine Wiese, dann ist die Hütte aus Stein zu sehen. Seltsam angelegte Wasserbassins, ebenfalls aus Stein und natürlich die unvermeidliche Quelle mit wohlschmeckendem Wasser.
Ich bin erstaunt über die Ruhe hier an dieser Stelle. Man sagt, dass hier bereits seit der Eiszeit Menschen gelebt haben und bis in die Neuzeit immer wieder Eremiten. Die Quelle ist heilig und das Wasser schmeckt tatsächlich richtig gut. Na ja, kein Wunder, in nur acht Kilometern Entfernung liegt die Stadt Vittel, dort wo die Firma Nestlé das Wasser für die ganze Welt abzapft und in Plastikflaschen verpackt.
Einsiedler im Mittelalter, das klingt wie der Traum eines introvertierten Minimalisten. Kein WLAN, keine Nachbarn, keine lästigen „Hast du schon die neueste Serie gesehen?“- Fragen. Stattdessen ein einsames Häuschen, nur du, dein Brot, ein paar Heilige Schriften und die unendliche Stille des Waldes. Morgens aufstehen, Wasser aus der Quelle schöpfen, vielleicht ein bisschen meditieren oder ein Gebet sprechen, und dann – ach ja – den ganzen Tag Zeit, über die großen Fragen des Lebens nachzudenken. Warum sind wir hier? Was gibt es zum Abendessen?
Irgendwie begleitet mich das Thema Stille, Ruhe und Zeit durch die ganze Reise. Immer wieder habe ich die Zeit durch Orte wie diesen zurückdrehen können und mich in längst vergangene Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende hineingedacht. Gottseidank habe ich auch immer wieder in der Gegenwart zurückgefunden. Und die ist auch gar nicht soooo schlecht. Leider regnet es heute, das erste Mal auf dieser Reise, wirklich fast ununterbrochen. Mein geplantes Picknick im Wald an der Quelle muss deshalb ausfallen. Ein Mittagessen in einem Restaurant steht stattdessen an.
Ich stapfe also zurück durch das kniehohe Gras, wieder vorbei an dem Jäger, der mir jetzt fast wie ein alter Bekannter vorkommt. Im Dorf finde ich ein kleines, gemütliches Restaurant. Die Kellnerin lächelt mich freundlich an und ich bestelle etwas Herzhaftes, um die Kälte und Nässe zu vertreiben. Während ich auf mein Essen warte, denke ich darüber nach, wie es wohl wäre, als Einsiedler im Mittelalter zu leben. Vielleicht gar nicht so schlecht – solange man immer mal wieder ins Dorf zurückkehren kann, um eine warme Mahlzeit zu genießen.
Mein heutiges Ziel? Das legendäre Kloster Cluny und die spirituelle Oase Taizé. Es liegt nur einen Steinwurf von meinem Campingplatz entfernt. Bereits bei meiner Ankunft auf diesem Platz fühle ich die mittelalterliche Atmosphäre. Sie ist so greifbar, dass ich beinahe erwarte, Mönche in Kutten um die Ecke biegen zu sehen. Doch anstelle heiliger Gesänge und strenger Gesichter finde ich in der Stadt und im Kloster natürlich Touristen mit Selfie-Sticks und Reiseführer in der Hand – ein bisschen enttäuschend, aber auch irgendwie beruhigend.
Das Kloster Cluny, gegründet um 910, war einst das Zentrum einer mächtigen Reformbewegung, die die Kirche ordentlich durcheinanderwirbelte. Man könnte fast sagen, hier wurde die mittelalterliche Version einer Kirchenrevolution gestartet. Und ich, der ich nicht gerade als Revoluzzer bekannt bin, stehe nun ehrfürchtig vor den imposanten Überresten dieser einst gigantischen Anlage und kann mir das Grinsen nicht verkneifen. Die Mönche von Cluny haben damals den Weg geebnet für eine tiefgreifende spirituelle und organisatorische Erneuerung der Kirche. Sie setzten auf Gebet, Disziplin und – jetzt haltet euch fest – soziale Gerechtigkeit. Anscheinend hatten sie schon damals ein feines Gespür für die Trends von morgen.
Doch genug der Vergangenheit. Mein nächster Stopp ist das kleine Dorf Taizé, nur einen Katzensprung von Cluny entfernt. Hier hat Frére Roger vor Jahrzehnten eine Bruderschaft gegründet, die das spirituelle Erbe von Cluny auf ihre eigene, moderne Weise weiterführt. Als ich das Dorf erreiche, empfängt mich eine friedliche Stille, die nur von sanften Gesängen und dem Lachen junger Menschen unterbrochen wird.
Die Brüder von Taizé leben hier in schlichter Gemeinschaft, ihre Tage sind geprägt von Gebet, Arbeit und Gastfreundschaft. Die Gottesdienste, die ich besuche, sind eine Mischung aus Musik, Stille und Gemeinschaft – und treffen mitten ins Herz. Besonders beeindruckt mich die längere Phase der Stille während des Gebets. Zehn Minuten können unendlich lang erscheinen, aber sie bieten den Raum für persönliche Reflexion und tiefes Gebet. Und ich, der ich sonst eher ein Fan von lauten, schnellen Dingen bin, finde in dieser Stille eine unerwartete Ruhe.
Vor mehr als 40 Jahren war ich das erste Mal hier. Damals wie heute hat dieser Ort nichts von seinem Zauber verloren. Die Brüder vermitteln eine Vorstellung von Liebe, die still und dennoch kraftvoll ist. Meiner Meinung nach ist die Liebe eben nicht laut und aufdringlich, sondern sanft und einladend. Die Brüder sprechen kaum, aber ihre Präsenz sagt mir viel.
Während ich durch die Gärten von Taizé schlendere, fühle ich mich wie in einer anderen Welt. Eine Welt, in der wieder einmal die Zeit keine Rolle spielt und in der die einfachen Dinge des Lebens plötzlich enorm wertvoll erscheinen. Ich verlasse Taizé mit einem Lächeln und einem Gefühl der inneren Ruhe, das mich hoffentlich noch lange begleiten wird.
Ja, das Reisen erweitert den Horizont. Und manchmal bringt es uns an Orte, die nicht nur die Landschaft, sondern auch das Herz verändern. Cluny und Taizé sind solche Orte. Orte, die uns lehren, dass die wahre Revolution in der Stille und der Liebe liegt.
Der Tag beginnt frühmorgens mit dem Duft von frisch gebrühtem Kaffee, der durch die Gassen zieht und mich magisch anzieht. Auf dem Markt herrscht bereits reges Treiben. Die Händler preisen lautstark ihre Waren an und ich kann nicht widerstehen – ein knuspriges Croissant muss sein. Ich gönne mir noch eine Handvoll frischer Erbsen, die ich vom Stand nebenan nasche, während ich durch die Marktstände schlendere. Ein kleiner Vorgeschmack auf die kulinarischen Genüsse, die Frankreich zu bieten hat.
Voller Vorfreude mache ich mich auf den Weg nach Cluny. Die Fahrt führt mich durch das Herz Frankreichs und pünktlich zur Mittagszeit halte ich an einem kleinen, unscheinbaren Bistro an. Hier erlebe ich einen wahren kulinarischen Höhenflug: Ein 3-Gänge-Menü, das selbst dem kritischsten Feinschmecker Tränen der Rührung in die Augen treiben würde, und das Ganze für sage und schreibe 22 Euro – inklusive Wein, Kaffee und Wasser. Frankreich, allein für solche Momente liebe ich dich.
Ach ja, könnt ihr auch das Gesicht in der Wasserflasche sehen? Ich glaube, es ist mein Schutzengel Friederike.
Cluny.
Touristen, wohin das Auge blickt. Was hatte ich auch anderes erwartet? Die Hotels und Pensionen sind allesamt überteuert, also beschließe ich, mein Zelt auf einem nahegelegenen Campingplatz aufzuschlagen. Direkt neben mir das Klo für alle – praktisch, aber nicht unbedingt die romantischste Vorstellung. Doch der Blick auf das majestätische Kloster Cluny in der Ferne entschädigt für vieles. Die Altstadt ist zu Fuß erreichbar, und nach einem langen Tag gönne ich mir ein Bier. Acht Euro kostet der Spaß, was mir einen kleinen Schock versetzt. Ich lasse mich trotzdem nieder und genieße die Atmosphäre.
Morgen steht der Besuch des Klosters an. Ich stelle mir vor, wie ich durch die historischen Mauern schreite, die einst so viel Bedeutung hatten und es auch heute noch tun. Danach geht’s weiter nach Taizé. Dort möchte ich an einer Messe teilnehmen und ein wenig innere Ruhe finden, bevor ich mich wieder Richtung Deutschland aufmache. Eine kleine Zwischenstation in Belgien steht noch auf dem Plan – ein ganz besonderer Ort wartet dort auf mich.
Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Jetzt lehne ich mich zurück, schaue auf die Sterne über Cluny und nehme einen letzten Schluck von meinem überteuerten Bier. Abenteuerlust und Genuss – das ist Frankreich für mich.
PS.: Ich sitze hier in einem Bistro, der Kellner, ein älterer Herr mit einem charmanten Lächeln, hat mich überzeugt, dass „Escargots“ eine Delikatesse sind, die ich nicht verpassen darf. „Das schmeckt himmlisch, glauben Sie mir!“ hat er gesagt, während er mir die Karte reichte. Und da bin ich nun, bewaffnet mit einer speziellen Zange und einem kleinen Gabelchen, bereit, mich dieser kulinarischen Herausforderung zu stellen.
Ich nehme die erste Schnecke vorsichtig mit der Gabel aus der Schale. Sie sieht glitschig und fremd aus, irgendwie nach etwas, das eher auf dem Boden des Gartens kriechen sollte als auf meinem Teller. Aber der Duft von Knoblauch und Butter steigt mir in die Nase, und plötzlich bin ich neugierig.
„Was soll’s“, sage ich mir und schiebe die Schnecke in meinen Mund. Die Textur ist überraschend zart und der Geschmack… Moment, das ist tatsächlich lecker. Ich schlucke und greife sofort nach einem Stück Brot, um es in die restliche Knoblauchbutter zu tunken. Himmel, diese Butter! Sie ist reich, würzig und hat genau die richtige Menge Salz. Es geht mir gar nicht so sehr um die Schnecken, merke ich. Es ist die Butter. Die verdammte, göttliche Knoblauchbutter.
Schnell noch ein halbes Dutzend Schnecken für mich. Schnecken. Vor ein paar Tagen habe ich sie noch fotografiert und nun…. oh Gott. Sie schmecken mir auch noch. Himmel hilf. Dabei geht es mir gar nicht um die Schnecken. Ich tunke mein Brot so gern in die Knoblauchbutter….
Jeder Tag ist ein neuer Anfang.

Frühstück in Frankreich.
Eine Tasse Kaffee mit Milch. Croissants und sonst nix. Es wird mir nicht langweilig. Besonders heute nicht, wo ich doch in einer alten Stadt in der Provonce bin.
Very nice hier, denke ich und fotografiere mir einen Wolf. Gut, dass ich so ein tolles Handy habe. Die sperrige Kamera habe ich im Auto gelassen.








Auch heute ist mir wichtig, wenigstens einen schönen Moment gehabt zu haben, der mich lächeln lässt. Am Ende waren es dann wieder viele wunderbare Momente. Ein ganz besonderer Augenblick ist die unerwartete Begegnung mit einer Ziegenherde mitten im Wald. Zuallererst sind da nur sanfte Klänge, die ich nicht zuordnen kann. Dann, wie aus dem Nichts, erklingen Glocken. Viele Glocken. Und plötzlich sind sie da, der Ziegenhirte und seine Gefolgschaft aus meckernden Ziegen, Schafen und seinen treuen Hunden. Ich stehe da, fasziniert von diesem unerwarteten Schauspiel, und wage kaum zu atmen, als die Chef-Ziege mit imposanten Hörnern an mir vorbeischreitet. Am Ende des Trosses, zwei nette Ziegenhirtinnen, ebenfalls mit Hunden und einer zutraulichen Ziege.
Das ganze war so außergewöhnlich schön im Sonnenlicht, dass ich noch lange, wie verzaubert, hinter ihnen herblickte, mich zum hundertsten Mal auf diese Reise bei meinem Schutzengel bedankte und verblüfft über das Timing des Glücks nachdenke. Schließlich hätte ich zu diesem Zeitpunkt ja auch ganz woanders sein können. In Timbuktu zum Beispiel. Bin ich aber nicht. Ich bin hier, hier auf einem Waldweg in Frankreich.
Das Sonnenlicht spielt mit den Schatten der Bäume, und ich fühle mich wie in einem Märchen aus längst vergangenen Zeiten. Es ist so surreal, dass ich mich mehrmals kneifen muss, um sicherzugehen, dass ich nicht träume. Doch die Realität dieses magischen Moments ist unbestreitbar.
Voller Dankbarkeit für das unvergessliche Erlebniss verweile ich noch lange an diesem Ort, bevor ich mich wieder auf die Suche nach den Spuren der Vergangenheit begebe. Dolmen und Menhire warten darauf, von mir entdeckt zu werden, und ich als moderner Zeitreisender kann es kaum erwarten, ihre Geschichten zu enthüllen. Denn hier, in der Provence, gibt es mehr als nur Lavendelfelder und Sonnenschein – hier liegt die Geschichte selbst auf den Wegen und in den Steinen verborgen, bereit, von denen entdeckt zu werden, die bereit sind, die Zeit zu überwinden. Für heute habe ich wieder am Wahlrad der Zeit gedreht, bis weit nach hinten in die Steinzeit. Und … siehe da, ich bin fündig geworden. Im Wald, neben einem Weg habe ich die Spuren der Menschen vor Menschengedenken gefunden. Ach…. aber seht doch selbst:
