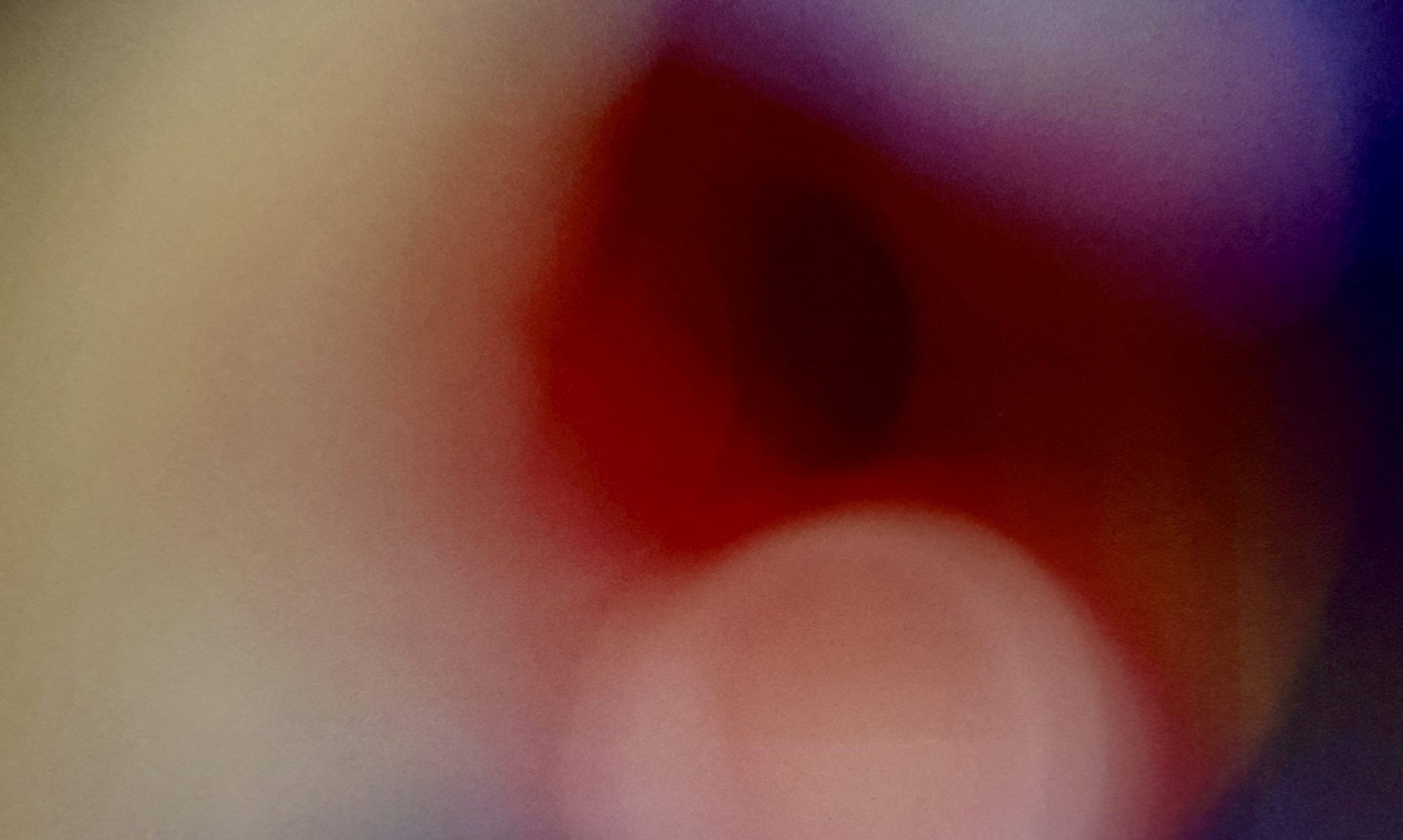Silbensammlerzeit
Wenn Sprache barfuß geht.
Ich liebe es, neue Worte zu finden. Nicht zu erfinden, sondern zu entdecken. Wie Kiesel im Bachbett. Am besten glattgeschliffen vom Leben.
Ich nenne sie Zwischenworte. Sie hocken im Schatten des Alltags, kauern zwischen zwei Halbsätzen, auf einem zerknüllten Einkaufszettel, im Geruch von nasser Erde. Kleine, unscheinbare Wörter, die im Herzen nachklingen.
Wie ich sie finde?
Sie tragen ein heimliches Leuchten, damit sie nicht verloren gehen. Das kann ich manchmal sehen. Sie blinken kurz auf, als wollten sie sagen: Nimm mich mit. Ich warte hier schon eine Weile.
Doch sonst sind sie ganz gewöhnlich. Worte, die jeder mindestens schon einmal gehört hat.
Aber kaum noch einer fühlt.
Sie wollen auch nichts erklären.
Nur berühren.
Es ist Silbensammlerzeit.
Die Zeit, in der ich mit Worten auf Wanderschaft gehe. Nicht weit. Oft reicht der Weg vom Küchentisch zum Fenster. Oder vom ersten Satz eines Liedes bis zur letzten Seite eines alten Buches.
Ich ziehe los mit leeren Taschen. Und komme zurück mit einem Wort, das ich noch nie so gesehen habe.
Feinmut war so eines.
Ich fand es zwischen einem Marmeladenglas und einem müden Morgengedanken. Es stand einfach da. Ohne Aufhebens. Feinmut. Nicht Übermut. Nicht Kleinmut. Nicht Wagemut. Etwas anderes. Etwas, das innehält. Lauscht. Und trotzdem geht. Mit leiser Kraft.
Oder das Wort Zwischenfroh.
Das sich einnistet in diese kleinen Momente, in denen nichts Großes passiert – aber etwas stimmt. Wenn das Brot gelungen ist. Der Regen an der Scheibe langsam abläuft. Und niemand etwas von dir will.
Ich trage ein Notizbuch bei mir, das schon längst keine Ordnung mehr kennt. Ich blättere darin wie durch ein fremdes Leben. Überall diese Wortfindlinge, die mir eines Tages zugelaufen sind. Manche warten noch. Andere haben sich längst in Texte geschlichen. Wie Kinder, die durchs Fenster schauen und irgendwann einfach hereinkommen.
Ich schreibe sie auf, weil ich sonst übersprudeln würde. Weil sich all die Worte in mir sammeln wie Regentropfen in einer hohlen Schale.
Ich glaube, dass Sprache keine Behauptung ist, sondern ein Zuhause. Kein Waffenlager, sondern eine Werkstatt. Kein Schild, sondern eine Schale.
Und jedes Wort, das wir entdecken, verändert die Art, wie wir die Welt sehen.
Wenn ein Mensch ein neues Wort in sich trägt, sieht er die Dinge anders. Wie durch ein Glas, das den Nebel lichtet.
Einmal schrieb mir jemand, sie habe beim Lesen ein Wort gefunden, das ihr Herz zurückgegeben habe. Es war nichts Großes. Kein Donner. Kein Glanz. Nur ein leises Wort. Aber es war das ihre. Und das genügte.
Ich glaube, dass viele Worte längst da sind.
Vergessen.
Verwildert.
Verstummt.
Aber noch warm.
Man muss sich nur bücken. Oder still genug sein. Damit sie zurückkehren.
Shakespeare tat das. Er war kein Erfinder, sondern ein Hinhörer. Er sammelte die Wörter von der Straße auf, aus den Gassen, aus dem Flüstern der Händler, aus dem Seufzen der Liebenden. Und manchmal baute er sich welche, weil es keine gab für das, was er fühlte.
So entstand eine Sprache, die keine Schule brauchte. Nur Mut und Ohr.
Vielleicht sollten wir es ihm gleich tun. In unserer Zeit. In unserer Sprache.
Ich denke oft: Es geht nicht darum, klug zu schreiben.
Oder originell.
Sondern wahr.
Wahr im Sinne von: da. Ein Wort, das da ist, wenn man es braucht. Das nicht zerrt. Nicht drängt. Sondern sitzt. Wie ein stiller Freund am Küchentisch.
Es ist ein schönes Gefühl, wenn so ein Wort sich zeigt. Wenn ich es streicheln darf mit Tinte. Wenn es plötzlich Platz nimmt in einem Satz, der vorher leer war.
Dann ist da etwas entstanden, das nicht laut werden muss.
Weil es lebt.
Und ich weiß:
Das ist genug.
Das ist
Sprache,
barfuß.
Wenn die richtigen Worte zur richtigen Zeit aufeinandertreffen, tanzen sie.
Springen auf,
drehen sich,
hüpfen,
verbeugen sich.
Flüstern.
Nicht irgendwo auf einer Bühne, sondern in Wohnzimmern. Dort, wo die Hausschuhe stehen, das alte Radio spielt und der Tee langsam abkühlt.
Behutsam nähern sie sich den Menschen. Berühren die Seelen.
Manche schüchtern.
Andere wild.
Silbenwirbel.
Gedankentänze.
Ein Reigen der kleinen Buchstaben.
„Ich bin da“, sagt ein Wort.
„Ich auch“, antwortet ein anderes.