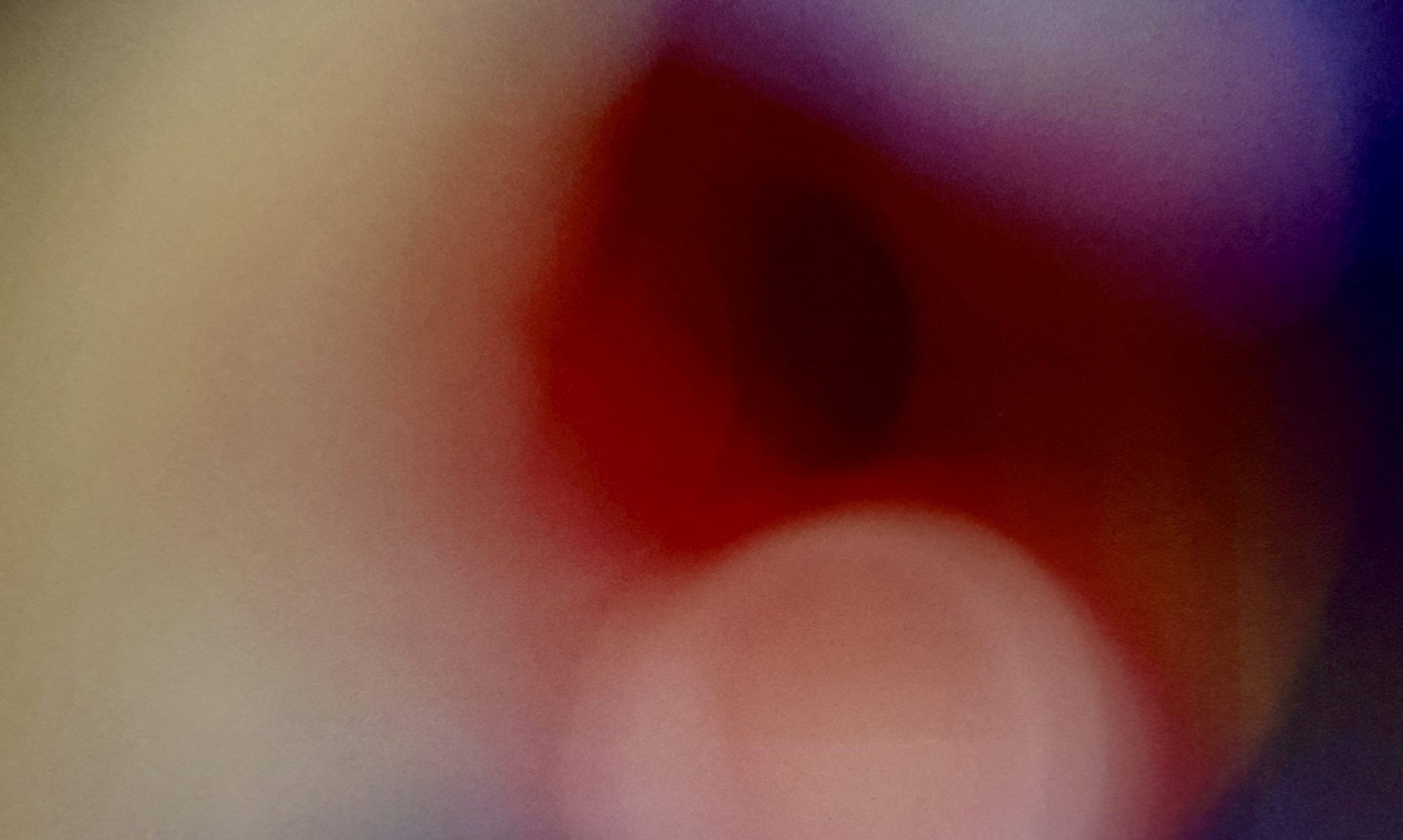Warum meine Seele
auf dem
Handrücken wohnt.
„Du bist viele – viel zu viele!“ – rief mir eine Freundin zu und blies die Backen auf. Das klang nicht nach einem Kompliment. Eher nach einer Kapitulation. Es schien, als hätte sie sich ergeben – vor den Ecken und Kanten, den Sprüngen und Brüchen meines Charakters. Eben noch war ich scheinbar verständnisvoll und liebevoll, im nächsten Moment aufbrausend und wie aus der Rolle gefallen. Rolle? Spiele ich eine Rolle? Ich glaube, ich habe sie erschreckt. Vielleicht suchte sie nach einem festen Kern, nach dem einen unverrückbaren Ich in mir. Und als sie ihn nicht fand, zweifelte sie. Zweifellos an meiner Authentizität.
Dabei ist genau das mein höchster Anspruch: authentisch sein! Ich habe mich nie als Schauspieler gesehen. Und doch: Ich kann tugendhaft sein – und im nächsten Moment vollkommen unmoralisch. Ich kann liebevoll sein – und zwei Minuten später grantig wie ein aus dem Takt geratener Regenschauer. Ich bin nicht viele. Ich habe nur viele Zustände. Aber die sind echt.
Die Zustände, sie schweben über mir, neben mir, unter mir. Manchmal übernehmen sie die Regie. Manchmal auch ich. Ich finde „Zustände“ viel bezeichnender als dieses ganze Gerede von Rollen. Wer von sich behauptet, stets derselbe zu sein, lügt. Oder hat einfach ein furchtbar langweiliges Innenleben.
War meine Freundin vielleicht nur bequem? Wollte sie einen leicht zu steuernden Menschen, einen Freund, der immer kalkulierbar ist? Und bin ich egoistisch, wenn ich meinen Stimmungen freien Lauf lasse?
Jesus soll gesagt haben, man solle werden wie die Kinder. Gute Idee! Aber ehrlich gesagt: Kinder sind auf entzückende Weise egoistisch. Sie sind Meister der Manipulation, sie können stur sein wie ein Granitblock oder anpassungsfähig wie Knetmasse. Ihre Antennen für Missbilligung und Anerkennung sind hochempfindlich. Je nach Bedarf wechseln sie ihre Strategie. Mal sind sie Engel, mal Teufel, mal unberechenbare Wetterphänomene. Eigentlich haben alle Kinder eine Persönlichkeitsstörung – vielleicht weil sie noch gar keine Persönlichkeit haben?
Und ich? Ich bin im Rentenalter und wechsle nur noch selten meine Zustände. Aber wenn, dann richtig. Bei Menschen, die ich mag, bin ich hemmungslos ehrlich. Ich denke nicht lange nach. Ich lebe meine Widersprüche aus. Ich verliere die Beherrschung, aber ich projiziere meine Probleme nicht in andere. Ich idealisiere niemanden. Und ich habe keine Angst davor, mir selbst einen Spiegel vorzuhalten.
Wie also gehe ich mit dieser Bemerkung um: „Du bist viele“? Ist das vielleicht doch ein Kompliment? Auch wenn es nicht so gemeint war?
Ich starte ein kleines Experiment. Ich werde mich erstens in selbstbewusster Demut üben. Nicht zu verwechseln mit Selbstverleugnung oder Unterwürfigkeit. Sondern eine Gelassenheit, die sich nicht provozieren lässt. Ein sanftes inneres Kopfnicken soll genügen, wenn meine Stimmungen mal wieder Kapriolen schlagen. Das ungehemmte Ausleben aller Höhen und Tiefen werde ich mir für Meditationssitzungen oder nächtliche Albträume aufheben. Mein Freundeskreis soll schließlich nicht unter mir leiden.
Zweitens werde ich meine Seele streicheln. Und zwar wortwörtlich. Ich habe mir ein kleines Stückchen Haut auf meinem linken Handrücken ausgesucht. Das ist von nun an, der Sitz meiner Seele. Immer wenn ich mich gut fühle, fahre ich sanft darüber.
Wenn es mir schlecht geht, werde ich dieselbe Stelle streicheln – um mein Gehirn zu erinnern: Da war doch mal Glück. Vielleicht lässt es sich auf diese Weise wieder einfangen.
Und drittens, am wichtigsten: Ich werde das Nichtstun kultivieren. Nein, nicht die Faulheit. Ich will von nun an noch genauer hinschauen, zuhören, statt zu viel zu sprechen. Mich meinen Lieblingsmenschen zuneigen. Auf ungebetene Ratschläge verzichten. Es ist dieses Nichtstun, das ich kultivieren will. Es zur hohen Kunst erklären, die ich fleißig üben werde. Schließlich ist das auch eine ehrenhafte Tätigkeit. Ich werde mich dem hingeben wie ein Zen-Mönch seinem Tee oder ein Kater seinem Nachmittagsschlaf. Denn wenn ich etwas freiwillig tue – auch wenn es nichts Aktives ist – dann ist es immer noch eine Entscheidung.
Und das ist doch auch wieder authentisch.
Ach, ich mache einfach, was ich will.
Das bin ich.
Ganz egal, wie viele ich bin.